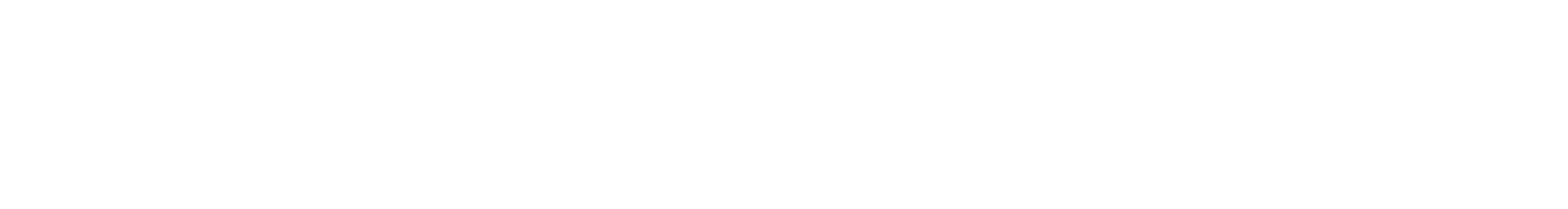Lachsfarming - die Gefahren der Netzgehegezucht
"Der Lachs -der gequälteste Fisch der Weit" lautet der Titel eines Buches von Anthony Netboy aus dem Jahre 1980. Er beschreibt darin umfassend, weichen Gefahren der Lachs bis zu seinem Lebensende ausgesetzt Ist. Schon damals war der Atlantische Lachs In seinem Bestand so stark gefährdet, daß ein Fortbestand auf Dauer als sehr zweifelhaft erschien.
Lachsfarming als Ausweg?
Große Hoffnungen setzte man damals in die gerade aufkommenden Lachsfarmen. Man hoffte, daß dadurch das vermehrte Angebot an Farmfischen ein Nachstellen auf Wildlachse nicht mehr lohnen würde. Tatsächlich wurde der Markt dadurch entlastet, doch bald entwicklete sich das Lachsfarming zum Bumerang.
Das breitere Angebot brachte die Preise bald zum Sinken. Langfristig so stark, daß heute jedes Kühlhaus übervoll und der Markt mehr als gesättigt ist.
So positiv dieser Aspekt aus der Sicht des Lachsfangs mit Rute und Rolle wegen der geringeren Ausbeutung der Wildlachsbestände wirken mag, so gravierend greifen die Nebeneffekte der Lachszucht in Netzgehegen in die natürlichen Gleichgewichte ein.
Genetische Verfremdung
Eine Massentierhaltung, vor allem aber das Lachsfarming, bringt große Gefahren mit sich - nicht nur für die gezüchteten Fische selbst. Bedingt durch den Streß sind die Fisch sehr anfällig gegen Krankheiten und den damit einhergehenden Befall von Parasiten. Die Lachsfarmer versuchen, dies zwar durch intensiven Einsatz von Medikamenten zu verhindern, oft aber ohne Erfolg. Immer häufiger kommt es vor, daß die Lachsfarmer die von Krankheit befallenen Bestände einfach freilassen, sei es um der Entsorgung aus dem Weg zu gehen oder auf dem Papier einen versicherungstechnisch relevanten Tatbestand (Ausbruch der Zuchtfische) zu erzeugen. Daneben brechen aber, besonders in Sturmwetterlagen, auch zahlreiche (noch gesunde) Lachse aus und steigen wie Wildlachse in die Flüsse auf. In manchen Flüssen beträgt der Anteil an Farmlachsen an den Aufsteigern schon bis zu 30%.
Umfangreiche Untersuchungen haben nun zweifelsfrei bestätigt, daß sich die Wildlachse mit Farmlachsen kreuzen. Dadurch ist eine genetische Verunreinigung der einzelnen Wildlachsstämme vorprogrammlert.
Es bleibt abzuwarten, inwieweit Urinstinkte verändert oder oder gar ausgelöscht werden. Bei den existierenden Mengenverhältnissen zwischen Farm- und Wildlachsbeständen (in norwegischen Flußmündungen und Fjorden häufig 50:1 und mehr) kann es nur eine Frage der Zeit sein, bis wilde Lokalpolulationen sich in Richtung auf die künstlich auf Zuwachs optimierten Erbeigenschaften des Mastlachses hin verändert.
Ein Paradies für Parasiten
Aber auch die angesprochenen Parasiten selbst stellen eine große Gefahr dar:
Im Westen Irlands sind die Meerforeilenbestände derzeit in ihrem Bestand akut gefährdet. Es hat sich herausgestellt, daß im Bereich der Netzkäfige eine explosionsartige Vemehrung von Meerläusen stattfindet. Diese befallen die Meerforellen-Smolts in solchem Maße, daß diese verenden oder ein Kümmerdasein fristen. Da die Meerläuse auch die Farmfische befallen, versuchen die Lachsfarmer wiederumn Abhilfe in Form der Chemiekeule zu schaffen.
Koordination tut not
In einem angemessenen Verhältnis könnte das Lachsfarming durchaus positiv zum Erhalt der Wildlachsund Meerforeilenbestände beitragen. Dazu sind vor allem strenge Regiementierungen und Vorschriften für die Betreiber notwendig.
Auf der gesamten Nordhalbkugelwerden heute Lachse für den Markt gemästet - ein internationales Problem. Unsere Mitarbeit in internationalen Organisationen ist angesagt.
Peter Olbrich 7/94