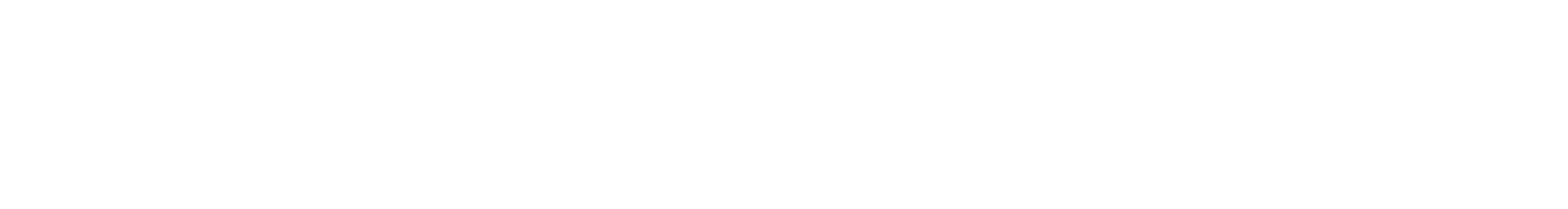Im folgenden Beitrag wirft Peter Olbrich einen umfassenden Blick auf die Situation der Salmoniden, mehr aber noch auf die Problematik der Heterogenität bei der Vernetzung der Fördermaßnahmen, bzw. der Bedeutung, die der Informationsweitergabe über sprachliche Grenzen hinweg zukommt. Er weist ausführlich auf die Wichtigkeit der Ziele Wiederansiedelung und Bestandsicherung hin und stellt die Statuten, bzw. die Agenda der LMS, die ein Beitrag zum internationalen Geschehen sein sollen, in den Vordergrund.
von Peter Olbrich
Richten wir einmal eine gigantische Kamera auf die Wandersalmoniden-Szene in Mitteleuropa und drücken auf den Auslöser. Schauen wir dann gemeinsam in der Dunkelkammer in die Entwicklerschale. Langsam zeigt sich etwa folgendes Szenario:
• tausend Angler die die Fische gerne fangen wollen
• hundert Angler, die dafür etwas tun wollen
• dreißig Angler, die mit Engagement lokal arbeiten, um Nachwuchs zu sichern
• zwanzig Umweltpolitiker, die sich die Wiederkehr der Wandersalmoniden ans Revers heften wollen
• zehn Behörden, die sich aus politischem Druck mehr oder weniger zwangsweise mit diesem Thema beschäftigen müssen
• zehn Personen oder Unternehmen, die eigenwirtschaftliche Interessen mit der Wiedereinbürgerung verbinden
• zehn Fischereifunktionäre, die jeweils ihre Institution mit diesem Thema profilieren wollen
• eine nationale Vertretung in den einschlägigen Europa-Gremien, die ausschließlich berufsfischereiwirtschaftliche Interessen vertritt
• zehn Redakteure, die gerne Sensationelles zu diesem Thema verbreiten würden
• tausende organisierte oder selbsternannte Naturschützer, die den Anglern ausschließlichen Eigennutz unterstellen
• ein fischereifeindliches Umfeld in der Gesellschaft, die Angler als "Tierquäler" sieht
• ein Einzelkämpfer, der Jahr für Jahr dafür sorgt, daß überhaupt Fische von der Hochsee zurückkehren
• fünfzig "Hobbyfischer", die erkannt haben, daß sich Wandersalmoniden als "Wildlachs" trefflich vermarkten lassen
• fünfzig Staustufenbetreiber, die die Fischdurchlässigkeit ihrer Anlagen ausschließlich durch die Brille ihrer Stromerzeugungsbilanz sehen
• tausend Landwirte, die durch ihre Bewirtschaftungsformen die Laichplätze der Salmoniden versanden und verschlammen
• hundert Angler, die Angst haben, daß mit der Wiederkehr der Wandersalmoniden ihre gewohnte Fischereiausübung eingeschränkt
oder verboten werden könnte
• zehn Experten, die das Vakuum des Fachwissens in unserem Lande aus ihrem persönlichen Blickwinkel und mit
unterschiedlichem Sendungsbewußtsein zu füllen versuchen.
Fürwahr ein buntes Bild, aber ungefähr das, was sich in Sachen Wandersalmonidenförderung und damit auch Förderung der Meerforelle in den letzten Jahren abspielt. Viele Probleme spiegeln sich in den o.g. plakativen Aussagen wider und es lohnt durchaus, die vorhandenen Strukturen einmal zu hinterfragen und aus Sicht der Anforderungen der Meerforelle zu beleuchten.
Versuchen wir, Nägel mit der Zange einzuschlagen ?
Jahrzehntelang hat sich die Bestandsförderung der einheimischen Fischarten an relativ ortsfesten Arten und Beständen orientiert. Unter diesen Voraussetzungen konnten mit lokalen Maßnahmen der klassischen Besatzwirtschaft mehr oder weniger nachhaltige Erfolge erzielt werden. Aber bereits beim Aal, dessen akute Schwierigkeiten Ede Brumund-Rüther so eindrucksvoll beschrieben hat, müssen wir heute feststellen, daß für einige Fischarten lokale Einzelmaßnahmen (z.B. seitens der lokalen Anglerschaft bzw. des lokalen Naturschutzes) für den langfristigen Erhalt der Art ins Leere gehen müssen. Viel eher kommt es darauf an, das Lebensumfeld für eine gegebene Fischart in seiner Gesamtheit so zu gestalten, daß die Art wieder das tun kann, was sie seit Jahrtausenden erfolgreich getan hat: nämlich sich selbst in stabilen Beständen fortzupflanzen und sich so selbst zu erhalten.
Dies gilt in Besonderheit für unsere Wandersalmoniden, die im Süßwasser laichen, dort aufwachsen, ins Meer abwandern und zum Laichen wieder in die Flüsse und Bäche aufsteigen.
Jetzt, wo nach ersten Wiedereinbürgerungserfolgen die Wandersalmoniden stärker in den Fokus des Interesses treten, wird auch offenbar, daß Bestandsetablierung, -aufbau und -förderung auf der Basis von lokalen Aktivitäten bei den Fischarten mit geografisch so weit ausgedehnten Lebensräumen Aufgaben sind, die nicht selten die gegebenen Möglichkeiten der bestehenden Strukturen übersteigen. Durchaus realistische praktische Fragestellungen des Wandersalmonidenschutzes wie: "Wie kann der Pächter des Flußabschnittes xyz Einfluß auf die Sperrwerksöffnungszeiten einer Anlage an der Flußmündung im Nachbarland nehmen?" zeigen die Notwendigkeit einer überregionalen Interessenvertretung, wenn es sich um Arten mit länderübergreifendem Lebensraum handelt.
Jeder gute Ingenieur oder Handwerker paßt sein Werkzeug der Aufgabe an, bevor er ans Werk geht. Nichts anderes gilt im Bereich des Natur- und Artenschutzes sowie der restaurativen Ökologie: Lebewesen mit übergreifenden Lebensräumen benötigen unterstützende Strukturen, die auf ebendiese Lebensräume wirkungsvoll Einfluß nehmen können. Bewegt man sich dagegen im Bereich von Teillösungen (z.B. Unterstützung im Süßwasser bei gleichzeitig existierender Ausbeutung im Salzwasser) besteht die Gefahr, daß die in einen Teilbereich des Lebensraums der Art investierten Aufwände anderenorts wieder zunichte gemacht werden. Dies ist eine mittelfristig nicht zu kompensierende Motivationshürde für alle an einer solchen Aktivität Beteiligten.
Kann diese übergreifende Aufgabe der Wandersalmonidenförderung vom herkömmlichen Angelverein, von regionalen Angler- oder
Naturschutzverbänden oder von Anglerverbänden geleistet werden?
In den frühen 80er Jahren, - in einer Zeit, die die Fischerei- Verbandspolitik stark mit emotionsgeladenen Themen wie Wettangeln und Setzkescher beschäftigt hielt - war diese Frage für eine Anzahl verantwortungsbewußter Angler aus dem erweiterten Autorenkreis der Zeitschrift "Der Fliegenfischer" eindeutig mit "nein" zu beantworten. Trotzdem wollte man sich einer aktiven Verantwortung für den Erhalt und die Gestaltung einer lebenswerten fischereilichen Umwelt für unsere Enkel nicht entziehen. Die Lösung lag für sie in der Gründung einer Interessengemeinschaft, die Lachs und Meerforelle speziell gewidmet ist und deren Aktivitäten vorrangig von den Bedürfnissen dieser Arten gesteuert wird. Die Idee zu einer freien, verbandsungebundenen Unterstützungsinitiative für die Wandersalmoniden war geboren - die Idee zur LMS.
Einfach tatenlos zu warten, bis die verbesserte Wasserqualität unserer Fließgewässer zur Selbstetablierung von Meerforellenbeständen führt, war der LMS zu wenig. Diese in Hinblick auf die Meerforelle seitens offizieller Stellen gerne verfolgte Strategie übersieht, daß die Meerforelle eben nicht nur wegen verschlechterter Wasserqualität verschwunden ist, sondern durchaus auch andere Veränderungen des Lebensraums wie Gewässerausbau und -aufstau ihren Anteil daran hatten. Und z.B. durch Aufstau eines Flusses überschlammte und übersedimentierte Kiesbänke legen sich nicht durch einfaches Abwarten wieder frei.
Ebenso wie der Drang zur Aktivität stand im Vordergrund, im Interesse der Wandersalmoniden die Kluft zwischen Theorie und Praxis möglichst klein zu halten, d.h. Kontaktaufnahme und Kooperation zu suchen sowohl mit der Wissenschaft als auch mit der praktischen Arbeit bereits bestehender lokaler oder regionaler Initiativen. Gerade diese Trennung war ein wichtiges Merkmal der "Meerforellen-Szene" der frühen 80er. Modellhaft denkbar war die
LMS somit nur als Katalysator zwischen Theorie und Praxis.
Eins steht jedenfalls fest: die Meerforelle braucht Unterstützung, wenn sie ihre Stellung im Ökosystem unserer Flüsse und Küstenmeere in überschaubarer Zeit wieder erreichen soll.
Nur wer kennt, der schützt, fördert und bewahrt
Bei Beginn der Förderarbeit durch die LMS bestand das erste Problem bereits darin, verläßliche Information über die Wandersalmoniden und die Meerforelle im speziellen bekommen.
Leider ist der Bekanntheitsgrad der Meerforelle in der deutschen Öffentlichkeit gering, denn in vielen Gewässern ist sie fast eine Angler- und Biologen-Generation verschwunden gewesen - die Tradition des Umgangs mit dieser Art somit unterbrochen. Viel wichtiges lokales Wissen über ihre Lebensweise im betreffenden Gewässer ist mit ihrem Verschwinden verloren gegangen. Ein Defizit, das es nunmehr wiederaufzuholen gilt. Darüber hinaus tat der Erfindungsreichtum des Fischmarketings mit Phantasie- Handelsnamen wie "Lachsforelle" oder "Fjordforelle" etc. ein Übriges, um die wahren biologischen Verhältnisse bei Lachs und Meerforelle für den Normalbürger erfolgreich zu verschleiern.
Jahrzehntelang hat sich hierzulande kaum mehr jemand wissenschaftlich mit der Meerforelle befaßt. Auf internationaler Ebene gesehen, ist die Lage ein wenig besser, aber daß noch der letzte wissenschaftliche Kongreß zur Meerforelle sich mit der Kernfrage auseinandersetzen mußte: "What is a sea-trout?" (Was ist eine Meerforelle?) macht den unbefriedigenden Stand der Forschung mehr als deutlich. Über allen bisher international gewonnenen Erkenntnissen schwebt darüber hinaus konstant die Ungewißheit, inwieweit Befunde aus einem Gewässersystem auf ein anderes legitim übertragen werden dürfen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Meerforelle, die - nach heutigen Maßstäben - mit einigermaßen sicherer Methodik erarbeitet worden sind, finden sich vorrangig im englischen oder skandinavischen Sprachraum. Forschungsergebnisse aus Norwegen wie West- Schottland sowie Wales beziehen sich fast durchweg auf Fischpopulationen aus gefällereichen Flußsystemen geringer Länge - eine Situation, wie sie für Mitteleuropa oder Deutschland kaum typisch ist. Lediglich die Populationen Ost-Irlands, Ost-Schottlands und Jütlands kommen in der Ausprägung der Laichflüsse den norddeutschen Flüssen bzw. den Oberläufen der deutschen Ströme einigermaßen nahe.
Allein um fachlich kompetent mitreden und -verstehen zu können, besteht somit die Notwendigkeit, das vorhandene fremdsprachige Material zu sichten und dahingehend zu selektieren, ob es für Maßnahmen in Mitteleuropa eine praktische Relevanz hat oder nicht. Das beginnt damit, sich Quellen für die Literatur und direkte Information zu erschließen. Dies allein ist eine Arbeit, die - gewissenhaft betrieben - eine fachlich qualifizierte, mehrsprachige Person bereits Vollzeit auslasten könnte. Erhebliches privates finanzielles Engagement, wie z.B. für eine Reise zum bisher letzten großen Wandersalmoniden-Weltkongreß nach Kanada, stellte sich für mich zwar als optimaler Einstieg dar, aber eben auch nur als ein Anfang. All das dort akkumulierte Wissen bedurfte und bedarf noch einer publizistischen Aufarbeitung und Umsetzung auf die hiesige Sprache und die mitteleuropäischen Verhältnisse und ebenso die in der "Szene" geschlossenen persönlichen Kontakte zu den international bedeutenden Salmonidenforschern einer anhaltenden Pflege, um sie für den deutschen Sprachraum zu erhalten.
Die Meerforelle muß bekannter werden. Weniger in den Sportfischerkreisen selbst - dort tut die Tourismusbranche und die Fischereipresse genug, wenn auch vorrangig unter dem Aspekt des Fangs als unter dem der Bestandserhaltung und -förderung - sondern darüber hinaus: Es gilt, das Bewußtsein über die Bedeutung der Meerforelle nachhaltig auch in den Kreisen zu verankern, denen sich die Politik direkt verantwortlich fühlt, bzw. in und aus denen die Grundlage für Entscheidungen gewonnen wird.
Ein Großteil der Förderung der Meerforelle muß aufgrund der häufig internationalen Struktur des Lebensraums zwangsläufig auf einem Level geschehen, auf dem die Durch- und Umsetzung wichtiger Maßnahmen ausschließlich über Entscheidungen in der Politik vorangetrieben werden können. Eine noch so engagiert vorgetragene Einzelstimme wird im Gewölbe der internationalen oder bereits der nationalen Politik ohne den notwendigen Hintergrund durch Masse oder Einfluß verhallen. Aber gerade auf dieser Ebene bietet das sich immer konkreter konstituierende Verordnungswesen zu Natur- und Artenschutz und Fischerei in der EU gegenwärtig Einflußmöglichkeiten, die unseren Wandersalmoniden in der Praxis wirklich helfen können, sofern es gelingt, die dort maßgebenden Personen mit genügend sachlicher Information zum Thema zu versorgen.
Mit welchen Regelungen den Wandersalmoniden wirklich gedient ist, läßt sich eben nur aus einem soliden praktischen wie theoretischen Wissen um die Lebensansprüche dieser Art ableiten. Gut gemeinte Entscheidungen am grünen Tisch aufgrund einer rein theoretischen Kenntnislage oder Analogieschlüssen von z.T. vollständig anders strukturierten Lebensräumen führen allzuleicht zu Aktivitäten und Festschreibung von Bedingungen, die praktisch an den Notwendigkeiten vorbeigehen.
Der Weg zur Schaffung eines Entscheidungsklimas mit zuverlässiger, praktisch verwertbarer Information ist sicherlich weit, aber nicht ungangbar. Man muß sich aber darüber im klaren sein, daß Maßnahmen, die sich konkret und sichtbar durch eine solide Etablierung eines Bestandes für alle erkenntlich auswirken sollen, nur in einem relativ langfristigen Prozeß erreichbar sein werden. Zeiträume von 10 und mehr Jahren stellen sicherlich eine realistische Größenordnung dar. Zu viele unterschiedlichste "Flaschenhälse" verhindern heute noch eine standortgerechte Bestandsentwicklung der Meerforelle. Die nächsten Schritte gehören auf festes Eis.
Das erste wichtige Bein der Meerforellenförderung ist also die Schaffung eines allgemeinen Informationsniveaus über den
aktuellen Stand des Wissens. Ausgerüstet mit dem notwendigen Grundwissen, kann die aktuelle Situation betrachtet und analysiert werden, um die Schwerpunkte für praktische Aktivitäten herauszuarbeiten.
Als Ausgangsfrage stellt sich: Was hindert die Meerforelle in unseren Breiten daran, ihren Lebensraum in früherem Ausmaß wieder zu besiedeln ?
Wer dieser Problematik nachgeht, kommt bald zu der Erkenntnis, daß man sich besonders um die Phasen im Zyklus der Entwicklung kümmern muß, in denen es zu Engpässen kommt, oder an denen im schlimmsten Falle der Lebenszyklus komplett unterbrochen wird. Zu den kritischen Faktoren zählen:
• Vorhandensein von geeigneten Laichgründen
• Ausreichende Aufwuchsareale im Laichgewässer
• Hindernisfreie Abwanderung ins Meer
• Mortalität im Meer
• Gesicherter Wiederaufstieg
Bereits aus dieser kurzen Aufstellung lassen sich Aufgabenfelder entwickeln, die zur Orientierung einer Förderung der Meerforelle dienen können:
• Loslösen von Denkweisen, die an lokalen Interessen orientiert sind (z.B. wie kann ich die Meerforelle zur Befischbarkeit an die
mir zugängliche Gewässerstrecke binden)
• Direkten Eigennutz zurückstellen • Kooperativ im Gewässersystem
zusammenarbeiten (Arbeitsgemeinschaft)
• Gemeinsame Ziele entwickeln
• Kompetenz verfügbar machen
• am Umfeld arbeiten (wenn notwendig, auch theoretisch und weit losgelöst vom Fisch selbst)
• Einfluß auf überregionaler und internationaler Ebene suchen
Die Keimzelle zum Wiederaufbau eines Meerforellenbestands gedeiht in der Praxis zumeist im Binnenland, an irgendeinem Bach oder Flußoberlauf, von dem historisch verbürgt ist, daß er einst diesen Fisch beherbergt hat. Anfangs oft nur im Kopf einer Einzelperson existent, stellt sich die Frage, wie man in dieser Richtung sinnvoll aktiv werden kann. Hier hat die LMS in vielen Fällen bereits Geburtshilfe durch Tips zum Aufbau einer Wandersalmoniden-Initiative geleistet.
Dort wo man schon weiter war, lag der Kern des Wiederaufbaus der Meerforellenbestände traditionsgemäß in den Händen der Sportfischerei und nicht etwa des klassischen konservativen Naturschutzes. Es ist mehr als fraglich, ob ohne den unbestrittenen Eigennutz der Sportfischer z.B. in Norddeutschland die wenigen restlichen endemischen Bestände der Meerforelle die heutigen Tage noch erlebt hätten. Entscheidende Triebfeder der aufopferungsvollen Bestandspflege in den 70er und 80er Jahren war zweifellos oft die Erhaltung der Chance, diesen wehrhaften Fisch "vor der Haustür" weiter befischen zu können. Genau dieser Aspekt hat dann auch z.B. im Niedersächsischen Binnenfischereigesetz seinen Niederschlag gefunden, welches die Befischbarkeit eng an die Bestandshege koppelt. Je erfolgreicher diese Arbeit in den Laichgewässern jedoch war, desto stärker formierten sich auch Kräfte, die daran interessiert waren, den Segen kommerziell oder semi-kommerziell zu nutzen. Unspezifische Regelungen der Fischerei in den Küstengewässern öffneten hier ein zuweilen auch finanziell recht lohnendes Feld für "Trittbrettfahrer". Bereits hier erwies sich der Arm eines an einem Flußsystem agierenden einzelnen Fischereivereins als zu kurz. Die Notwendigkeit, sich innerhalb eines Flußsystems über die Maßnahmen zur Förderung mit anderen Pächtern und Fischereirechtsinhabern abzustimmen, ist nirgendwo dringlicher als in der Wandersalmonidenhege. Kommt eine solche Abstimmung nicht zustande, hat die Förderung keine Chance auf langfristigen Erfolg.
Ein besonderes Problem ist in diesem Zusammenhang die Diskrepanz zwischen der relativ hohen personellen Fluktuation der
Verantwortlichen in den Vereinen und der zwangsläufigen Langfristigkeit der Förderungsmaßnahmen. Vorstände, Gewässerwarte etc. wechseln nicht selten im 3-Jahres-Rhythmus. Es gibt keine Gewähr, ob eine neue personelle Führung eines Vereins der Wandersalmonidenförderung einen gleich großen Stellenwert einräumt wie ihre Vorgänger. Diese Entscheidungen hängen hier nicht selten von ganz anderen als sachlichen oder fachlichen Kriterien ab. Auch in Vereinen, die über ein existierendes oder potentielles Meerforellen-Wasser verfügen, gibt es zuweilen numerisch dominante Fraktionen, die dem sportfischereilichen und hegenden Engagement in dieser Richtung wenig Gegenliebe entgegenbringen.
Das Faktum, daß man die Präsenz von Wandersalmoniden z.B. in einem Vereinsgewässer nicht mit ausschließlich vereinsinternen Maßnahmen sichern kann, sondern nur wenn die gesamte Fischereiszene eines Gewässersystems mitzieht, ist vielen Mitgliedern nur schwer zu vermitteln. Heißt es doch in der Vereinspraxis: mit Rücksicht auf die Nutzung der Gesamtressource auch Verzicht zu üben, der anderen als den eigenen Vereinskollegen und ggfs. sich selbst zu Gute kommt. Wer seine Mitgliedschaft in einem Fischereiverein lediglich im Blickwinkel des günstigen Erwerbs der Dienstleistung "Fischereimöglichkeit verschaffen" sieht, hat wenig Motivation, Maßnahmen mitzutragen, von denen er nur am Rande profitiert. Leider ist diese Haltung in unseren Fischerei- und Angelvereinen immer mehr auf dem Vormarsch.
Oft hängt die fachlich fundierte Arbeit vor Ort an Einzelpersonen mit hoher persönlicher Motivation, die, wenn sie einmal ausfallen, oder ihnen durch höhere Gewalt der Wirkungskreis entzogen wird, ein empfindliches Vakuum hinterlassen. Für eine kontinuierliche Aufbauarbeit an einem Flußsystem, kann dies einen erheblichen Rückschritt bedeuten, der im schlimmsten Falle genau dann eintritt, wenn erste Erfolge die Chance zum Durchbruch in der Öffentlichkeitsarbeit bieten.
Eine Grundforderung geht somit dahin, die Wandersalmonidenförderung aus dem "potentiell labilen" Umfeld
der Vereine auf eine Ebene zu heben, in der diese Risiken erfolgreich kompensiert werden können. Im Klartext heißt dies: langfristig geht ohne eine Wandersalmoniden-Arbeitsgemeinschaft für das Flußsystem nichts. Wo immer notwendig, hat die LMS die Bildung von Arbeitsgemeinschaften an den Gewässersystemen propagiert und aktiv unterstützt.
Genauso wichtig ist die Bildung adäquater Strukturen auf der Ebene darüber, wie es die norddeutschen Sportfischerverbände in der Vergangenheit mit der "ARGE" - der heutigen Arbeitsgemeinschaft für Fischartenschutz AFGN - so vorbildlich betrieben haben. Es sei nicht unerwähnt, daß auch hier die Kontinuität lange Zeit eng mit dem persönlichen Engagement von Einzelpersonen existentiell verknüpft war.
Was allerdings bisher fehlt, ist eine nationale Struktur mit spezifischer Fachkompetenz, welche die Interessen der Wandersalmoniden im zweiten Teil ihres Lebensraumes, dem Meer, wirkungsvoll vertreten kann. Speziell für die küstennahen Meere, die noch im direkten Hoheitsbereich der einzelnen Nationen stehen, sind die Interessen der Wandersalmoniden nur ungenügend repräsentiert.
Wer sich einmal mit der kommerziellen Meeres- und Küstenfischerei-Szene näher beschäftigt hat, wird sich schnell bewußt, daß dies kein Ort für ökonomieferne Idealisten ist. Ohne staatliche und entsprechend kontrollierte Verordnung, Subvention oder handfeste finanzielle Vorteile oder ökonomischen Druck sind hier keinerlei Veränderungen zu erwarten. Als effektivste Einflußnahme auf diese Sphäre hat sich bisher der lange Arm über die Politik und die finanzielle Kompensation erwiesen. Für den Hochseebereich hat der Isländer Orri Vigfusson die Möglichkeiten dieser Strategie allen Unkenrufen zum Trotz soweit ausreizen können, daß durch die Lachsquotenaufkäufe seines NASF (North Atlantic Salmon Fund) die schwer geschundenen atlantischen Wildlachspopulationen endlich etwas Zeit zum Durchatmen gewonnen haben.
Für die Küstenfischerei fehlen bisher diese Strukturen. So können z.B. holländische Küstenfischer vor der Rheinmündung vollkommen legal und seelenruhig die Früchte des Programms Lachs 2000 ernten.
Daß Erfolge wie die des NASF, der heute durch finanzielle Kompensation in Millionenhöhe aus weitgehend privaten Mitteln jährlich Zehntausenden von Lachsen auf der Hochsee das Leben erhält, nur über hartnäckigste Arbeit in der internationalen Politik und Wirtschaft erreicht werden konnten, unterstreicht: effektive Wandersalmonidenförderung übersteigt einen lokalen sportfischereilichen oder biologischen Rahmen bei weitem.
Was als weiterer Baustein neben der bisher schon recht solide existenten lokalen und regionalen Förderungsarbeit notwendig ist, ist eben ein wirtschaftlichen und politischen Interessen gegenüber durchsetzungsfähiges Ressourcen Management, das sich auf ganz anderen praktischen Arbeitsfeldern abspielt als am Wasser und im Bruthaus - nämlich in Presse, Empfängen und anderen wichtigen sozialen Zusammenkünften der politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich Einflußreichen und Prominenten.
Welche Institution könnte die o.g. Ziele in die Realität umsetzen ? In den etablierten "Lachsländern" wie Großbritannien und teilweise in Frankreich und Spanien gibt es diese Institutionen - gesellschaftlich hochrespektierte Vereinigungen zum Schutze der Wandersalmoniden. Daß solche Vereinigungen als Schirmherren (oder sogar aktive Mitglieder) Persönlichkeiten im Range eines Prinz Charles aufweisen können, ist sicherlich aus dem jahrhundertealten sozialen Hintergrund der Lachsfischerei jenseits des Kanals zu erklären. Es wäre naiv, zu glauben, man könne innerhalb überschaubarer Zeit eine ähnlich einflußreiche Interessenvertretung für die Wandersalmoniden hierzulande aus dem Boden stampfen, wo die vorgenannte Tradition in diesem Ausmaß fehlt, schon weil für sie in den letzten 50 Jahren durch die weitgehende Abwesenheit der Wandersalmoniden keine Grundlage gegeben war. Um unter den hiesigen Gegebenheiten sinnvoll - wenn auch ggfs.
langsam - vorankommen zu können, gilt es die Realitäten im Auge zu behalten und nach Behelfs- oder Zwischenlösungen zu suchen, die sich am Gegebenen und Machbaren orientieren.
Da Entscheidungen, die die Küstenregion betreffen, hierzulande zumeist auf landespolitischer Ebene fallen, ist es unabdingbar, sich im Sinne der Wandersalmonidenförderung wirkungsvoll in den Entscheidungsprozeß einzubringen. Hier - wie überall in der Politik - zählt neben guten Argumenten auch die Masse an Menschen, die man hinter eine Fahne bringen kann. Masse kann die Anglerschaft vor allem über ihre Verbände einbringen. Zur Mobilisierung eines Mindest-Supports ist also mittelfristig wichtig, die Interessen der Wandersalmoniden auch im Bewußtsein der Verbandsfunktionäre auf Landesverbandsebene der Küstenländer nachhaltig zu verankern, denn diese haben unter den gegebenen Bedingungen den längsten und kräftigsten Arm. In Anbetracht der Tatsache, daß der Aufgabenbereich von Landesverbandsfunktionären allerdings extrem breit gefächert ist, kann die genannte Strategie jedoch nicht davon entbinden, an der Bildung einer Struktur weiterzuarbeiten, die Wandersalmonidenbelange im Küstenbereich übergreifend vertritt, es sei denn, die Wandersalmonidenförderung bekäme in den Landesverbänden den Status eines eigenen Referats in der Verbandsarbeit oder einer gemeinsamen Stabsstelle aller Küsten- Landesverbände und damit die Effektivität, die sie im sensiblen Bereich der Küste bitter nötig hat.
Auch hier treffen wir wieder - und zwar in den fischereilichen Reihen selbst - auf das Kernproblem: die Information.
Meerforelle und Lachs - eine publizistische Zweckehe
Der Lachs ist von der Seite der direkten Publizität der größte Feind und Freund der Meerforelle zugleich. Überall wo es im weitesten Sinne um Wandersalmoniden geht, wird stets der Lachs an erster Stelle gesehen.
Woran liegt das ? • Der Lachs hat eine historische Tradition
• Der Lachs hat ein mehr oder weniger festes Image in der Bevölkerung
• Der Lachs hat weniger flexible und damit leichter kalkulierbare Verhaltensmuster als die Meerforelle
Auch wenn es aus biologischer Sicht natürlich falsch ist, Lachs und Meerforelle in einen Topf zu werfen, so kann jedoch die Meerforelle von vielen Förderungsmaßnahmen des Lachses profitieren, zumal viele Gewässer früher beide Arten nebeneinander enthalten haben.
Für die Praxis gesehen heißt dies, daß es keinen Sinn macht, die Förderungsarbeit für die Meerforelle vom Lachs abzukoppeln. Die auf diese Weise längere Hebel für die Öffentlichkeitsarbeit rechtfertigt dies. In fortgeschritteneren Stadien, d.h. wenn erst einmal eine gewisse Basis an Akzeptanz im Lande geschaffen ist, ist allerdings genau diese Differenzierung notwendig, für die die Öffentlichkeit gegenwärtig noch nicht empfänglich ist. Dann ist die sachlich getrennte Betrachtungsweise gerechtfertigt, weil
• Meerforellen-Bestände andere Generationszyklen besitzen • Meerforellen-Populationen oft in spezifischen Abhängigkeiten
zu stationären Forellenpopulationen stehen können und zwar besonders in Hinblick auf genetischen Austausch und zeitweiser Revierkonkurrenz
• die Neigung zur Nahrungsaufnahme im Süßwasser bei der Meerforelle stärker ausgeprägt ist als beim Lachs
• Lachse und Meerforellen unter bestimmten Bedingungen im Laichplatzkonkurrenz treten können.
Worauf muß eine Öffentlichkeitsarbeit für den Fisch nunmehr abzielen?
• Erhöhung des Bekanntheitgrads der Art • Verdeutlichung der Funktion der Art im ökologischen Umfeld • Intensivierung der Forschung • Nutzung des "Kielwassers" des Lachses
Theorie ohne Praxis ist brotlose Kunst
Es gibt viel zu tun .... Dieser bekannte Satz aus der Werbung trifft auch auf die Wandersalmonidenförderung zu. Doch Ärmelhochkrempeln und Machen führt zwar mittelfristig nicht selten zu Erfolgen und zu einem guten Gewissen, aber leider langfristig auch in die Ernüchterung, wenn am falschen Ende begonnen wird.
Aus den bisher gemachten Erfahrungen und den herrschenden Randbedingungen sind zwei strategische Stoßrichtungen für die praktische Arbeit langfristig erfolgversprechend:
• Wiederansiedlung
• Bestandssicherung mit dem Ziel sich selbst
erhaltender Bestände
Zielrichtung 1 - Wiederansiedlung
Obwohl genaue historische Angaben fehlen, kann man derzeit für Deutschland davon ausgehen, daß in der Größenordnung von ca. 10-20% der historischen und damit potentiellen Meerforellengewässer derzeit wieder von diesem Fisch frequentiert werden. Das Wiederansiedlungspotential ist somit groß.
Natürlich hat sich in vielen Gewässern die Flußstruktur und - morphologie entscheidend verändert, in vielen ist aber die Meerforelle aus Ursachen verschwunden, die durchaus in ökonomischem Rahmen zu beheben oder bereits behoben sind. Pionieraufgaben dieser Art entwickeln nicht selten eine rasche Blüte auf lokaler Ebene, weil die Befürwortung einer Wiedereinbürgerung aus einem unterbewußten Schuldgefühl an der Zerstörung der Natur scheinbare Erleichterung des "schlechten Gewissens" verschafft. Vor zu früher Euphorie kann aber nur gewarnt werden. Kann z.B. die Presse nicht kontinuierlich mit Erfolgsmeldungen am Thema gehalten werden - und bei Wandersalmoniden können ganze Jahrgänge ausfallen - ist das breite Interesse und die Unterstützung schnell verflogen. Sind erst einmal Berichte über Probleme mit der Wiedereinbürgerung oder über ein mögliches Scheitern draußen, sorgt erfahrungsgemäß sofort die sonst schweigende Lobby der Trittbrettfahrer, die angeblich sowieso schon immer gesagt haben, das alles sinnlos ist, dafür, daß die Unterstützung lawinenartig
schwindet. Aus Freud und Leid der bisherigen Pionierarbeit hat sich folgende sinnvolle Vorgehensweise herauskristallisiert:
• Voraussetzungen prüfen
• Material sammeln
• Mitstreiter suchen bevorzugt unter Multiplikatoren
• historisches Material in die Öffentlichkeit bringen
• Gewässerstruktur aus Wandersalmonidensicht dokumentieren
• Arbeitsgemeinschaft gründen
• Kontakt zu anderen Initiativen pflegen
• Projekt planen und mit Betroffenen abstimmen
• In Abstimmung mit der Akzeptanz der Idee in
praktische Wiedereinbürgerung einsteigen
Zielrichtung 2 - Bestandssicherung mit dem Ziel sich selbst reproduzierender Bestände
Hier verdienen besonders zwei Aktivitätsbereiche verstärkte Aufmerksamkeit:
• Biotopstrukturen verbessern
• Kontinuität der lokalen Fördermaßnahmen absichern
Auch Gewässer, die die Meerforelle wieder oder noch immer frequentiert, sind nicht ohne Probleme. Vielerorts ist ein Status erreicht, in dem die Population zwar vorhanden ist, aber immer noch am Tropf der künstlichen Vermehrung hängt.
Der Schwerpunkt sollte hier besonders stark auf der Verbesserung der Biotopstrukturen liegen. Neben der praktischen Arbeit am Wasser (z.B. Zugänglichmachung kleinerer geeigneter Seitenbäche) sind z.B. Umstrukturierungen zur Herstellung einer naturnäheren Gewässermorphologie allerdings wiederum nur über den mühsamen Weg über die Institutionen zu erreichen. Auch hier gilt: Förderung muß nicht nur am Wasser stattfinden, sondern auch am Schreibtisch, Telefon, in Behörden, bei Parteien etc..
Nur durch Wiederherstellung eines genügend großen Laich- und
Aufwuchsareals kann eine durch regelmäßige menschliche Unterstützung "stabile" Population "selbständig" werden und den Fördermaßnahmen durch Angler den Geruch des "Edel-put-und- take" genommen werden. Letzteres ist wiederum eine Voraussetzung, um in unserer Gesellschaft für diese Aktivitäten Akzeptanz und Unterstützung zu finden und uns die Nische im Gewissen der Öffentlichkeit mitzuerobern, die die klassischen Naturschutzverbände schon länger positiv besetzen - nämlich die "edle, uneigennützige Gesinnung" zum Wohle unserer natürlichen Umwelt und damit des Menschen.
Auf das Problem der personellen Kontinuität der Förderung an einem Gewässer wurde bereits hingewiesen, doch die Fortführung guter Ansätze kann noch aus weiteren Gründen ins Schlingern geraten.
Trotz Berücksichtigung bereits gemachter Erfahrungen muß in der praktischen Förderungsarbeit jederzeit mit Turbulenzen und potentiellen Bremsklötzen gerechnet werden. Dabei stehen oft Ursachen und Wirkung in keinem Verhältnis. Beispielsweise dann, wenn Mittel aus öffentlicher Hand zur Finanzierung im Spiel sind, können leicht Situationen entstehen, in denen die langwierige Behebung eines - z.B. kleineren finanziellen - Problems auf dem bürokratischen Normalwege ein ganzes Projekt in Frage stellen kann, weil sich biologische Vorgänge wie die Wanderung der Großsalmoniden nun einmal nicht auf bürokratische Zeitraster synchronisieren lassen. Hier ist dann unbürokratisches und schnelles Eingreifen gefragt. Mehrfach hat die LMS in der Vergangenheit durch spontane Unterstützung auf dem kurzen Wege in Projekten Steine aus dem Weg geräumt, an denen der Zug zu entgleisen drohte.
Am Beispiel der öffentlichen Förderung von Wiedereinbürgerungsprojekten können noch weitere wichtige Punkte für die Praxis der lokalen Arbeit festgemacht werden. Grundsätzlich ist eine Beteiligung öffentlicher Stellen an Wandersalmoniden-Projekten zu begrüßen. Um aber herbe Enttäuschungen zu vermeiden, sollte man bereits im Stadium der Vorplanung unbedingt darauf hinweisen, daß
• keine Garantie für einen kurzfristigen Erfolg gegeben werden kann,
• substantielle Ergebnisse (d.h. eine "echte" Wiedereinbürgerung mit selbsterhaltenden Beständen) frühestens in ca. 10 Jahren zu
erwarten sind und die Beteiligung im Idealfall über einen derartig langen Zeitraum gewährleistet sein sollte,
• lokal isolierte Maßnahmen ein extrem hohes Risiko des Mißlingens und den Nachteil einer ständigen Abhängigkeit von
nicht beeinflußbaren Dritten mit sich bringen.
Da unter diesen realistischen Rahmenbedingungen kurzfristig nur wenig sicher vermarktbares umweltpolitisches Kapital zu erwarten ist, läßt die Bereitschaft, sich für die Wandersalmoniden öffentlich wie finanziell zu engagieren, zumindest bei politisch orientierten Kreisen nicht selten abrupt nach. Zwar reicht heute die Rückkehr von Einzelfischen als Erfolgsmeldung oft noch aus, aber eine durch die Natur- und Umweltschutzverbände immer besser informierte Öffentlichkeit wird sich in Zukunft mit solchen Pseudo-Erfolgen immer schwerer abspeisen lassen.
Je nach persönlicher Einstellung und dem Engagement der Verantwortlichen gibt es aber - trotz oder unter bewußter Inkaufnahme der oben genannten Erschwernisse - öffentliche Beteiligungen, die einer sinnvollen Wandersalmonidenförderung sehr entgegen kommen. Es bestehen durchaus Möglichkeiten, öffentliche Mittel sinnvoll einzubinden. Das Hauptproblem ist dabei, Maßnahmen zu definieren, für deren Durchführung die notwendigen organisatorischen Rahmenbedingungen mit der langwierigen und unflexiblen Bereitstellung der Mittel abstimmbar sind. Es ist sehr frustrierend, festzustellen, daß dann, wenn die Mittel abrufbar sind, die Maßnahme aus irgendeinem Grund nicht durchführbar ist. Dieses Risiko ist besonders hoch, wenn die Maßnahmen von der Kooperation von Mutter Natur abhängig sind (z.B. Eierbeschaffung).
Besser einsetzbar sind diese Mittel im Rahmen der Biotopverbesserung. Geradezu ideal sind z.B. Wehrumbauten. Dabei ist der einzige schlecht kalkulierbare Faktor die
Wasserführung im Gewässer; die Bezuschussung von Bauvorhaben ist dagegen ein eingefahrenes Verfahren im Verwaltungsbereich, welches in der Regel problemlos abläuft. Darüber hinaus besteht nach Abschluß der Maßnahme ein für alle erkennbares Ergebnis - ein vorzeigbares Resultat, welches man den wenigen in dieser Hinsicht engagierten öffentlichen Stellen nicht vorenthalten sollte. Mit Recht ist man z.B. in Nordrhein-Westfalen stolz auf die kostenintensiven Wehrumbauten im Siegsystem, die dort das bestzugängliche Laichareal für die Wandersalmoniden im gesamten Einzugsgebiet des Rheins geschaffen haben.
Steuerungsaufgaben wie der o.g. Mitteleinsatz erfordern von einem Projekt-Steuerungsgremium, an dem im Idealfall alle am Flußsystem betroffenen Institutionen und Kreise repräsentiert vertreten sind, Management-Fähigkeiten und Fingerspitzengefühl. Als Grundsatz kann gelten, daß die am Projekt Beteiligten das Gefühl haben müssen, auch Anteil am Erfolg zu haben. Am besten ist natürlich, wenn dieser auch noch direkt ableit- und vorzeigbar ist.
Die Verwaltung öffentlicher Mittel liegt naturgemäß zumeist in der Hand von Büro- und Technokraten, für die z.B. die Wandersalmonidenförderung ein Tätigkeitszweig unter vielen ist. Es kann nicht erwartet werden, daß diese Kreise eine intime Sachkenntnis über das schwierige Feld der Biologie und des Ressourcen-Managements von Wandersalmoniden mitbringen oder kurzfristig erwerben. Es besteht daher die Gefahr, daß der Mitteleinsatz vorwiegend in Bereiche geht, die einfach überschaubar sind. Dies entspricht aber keineswegs immer den Anforderungen der Praxis.
Wie das aussehen kann, lehrt eine Rückbetrachtung der Bemühungen unserer französischen Nachbarn in den 70er Jahren. Nach einem besorgniserregenden Rückgang der Lachsbestände in Frankreich wurden 1976 von zentraler Stelle 70 Millionen Franc im Rahmen des "Plan Saumon 1976-1980" zur Wandersalmonidenförderung bereitgestellt. Der größte Teil des Geldes floß in Verwaltungsarbeit, die Abwicklung von Meetings und
in wissenschaftliche Studien, die heute in irgendwelchen Archiven vor sich hin schlummern. Nur ein kleiner Teil kam konkret umsetzbaren Maßnahmen zugute, die immerhin zu Folge hatten, daß sich der Lachsbestand zumindest kurzfristig in den frühen 80ern etwas erholte. Wieviel mit dieser Summe bei einem besseren Einsatz hätte bewirkt werden können, steht in den Sternen - weniger als das Erreichte wohl kaum.
Mehr noch als in Frankreich, wo immerhin eine durchgängige Lachstradition in Fischerei und Forschung besteht, sind Förderungsprojekte in Ländern, wo die Wandersalmoniden nur einen geringen bis nicht existenten Stellenwert besitzen, abhängig von einer fachlich fundierten Steuerung. Leider sind öffentliche Institutionen mit dem nötigen Know-How in unseren Breiten dünn gesät. Im deutschen Sprachraum ist mir bis heute nicht eine einzige derartige Institution bekannt, in der diese für eine sinnvolle Förderung notwendige Fachkompetenz zum augenblicklichen Zeitpunkt ausreichend vorhanden wäre.
Nichts liegt näher, als sich in einer derartigen Situation der Erfahrung aus dem Ausland zu bedienen. Die LMS hat in den vergangenen Jahren tatkräftig mitgeholfen, Kontakte zu kompetenten Fachleuten des Auslands herzustellen. Leider hat man sich seitens der offiziellen Stellen in wichtigen Fällen - so z.B. zur Planung eines Gesamtprojekts für den Rhein mit norwegischer Fachunterstützung (übrigens vor deren Entscheidung zu einem EU- Nichtbeitritt) - zu einer Zusammenarbeit nicht entschließen können. Wenn man die jetzige Situation im Rheinsystem betrachtet, wo eine Gesamtkoordination praktisch nicht mehr stattfindet, schmerzt die damalige Ablehnung umso mehr. In der heutigen Zeit der internationalen Zusammenarbeit in Europa sollte eigentlich länderübergreifende Kooperation im Sinne der Sache Vorrang vor nationalen Alleingängen haben.
Doch wozu die LMS ?
Ziel einer Meerforellenförderung muß sein, einem zur Bestandssicherung ausreichenden Teil der Fischpopulation eine Vollendung des kompletten Lebenszyklus zu ermöglichen. Wir, d.h. die LMS, sind uns bewußt, daß die Sorge um den Erhalt und den Wiederaufbau der Wandersalmonidenbestände in Mitteleuropa solange ihre Seele im Engagement der Freizeitfischerei haben wird, bis eine wirtschaftliche Nutzung wieder in den Rahmen der Betrachtung gerät. Von diesem Status sind wir gegenwärtig meilenweit entfernt.
Wenn sich nicht die Angelfischer mit ihren langfristigen Nutzungsinteressen für die Wandersalmoniden einsetzen, wird sich ihre "Förderung" in Mitteleuropa auf bloßes Abwarten beschränken, sofern sich nicht umweltpolitisches Kapital daraus schlagen läßt. Daß Wandersalmoniden in dieser Hinsicht unzuverlässige Partner sein können und nicht unbedingt mit Legislaturperioden kooperieren, wurde bereits dargestellt. Also: praktisch wirksame Wandersalmonidenförderung läuft derzeit über die Angler oder sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht.
Nicht alle Angler sind organisiert. Leider haben sich kritisch orientierte und gesellschaftlich einflußreiche Kreise der Anglerschaft mit z.T. sehr sachkundigem Potential aus den verschiedensten Gründen von den Verbänden abgewandt. Nichtsdestotrotz stehen sie für aktive Maßnahmen im Sinne der Sache gerade - und sei es nur finanziell fördernd. Die LMS meint: wem die Wandersalmoniden und deren Fortkommen wichtig sind, soll auch an deren Förderung teilhaben können. Daher ist die LMS, der notwendigen Unterstützung der Wandersalmoniden willen, bereits vom Grundprinzip her verbandsungebunden. Genauso wichtig ist ihr aber die Offenheit gegenüber den Verbänden und anderen Institutionen. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit deren Gremien - wie z.B. der AFGN der norddeutschen Landesfischereiverbände - sind bereits eine Selbstverständlichkeit. Die Wandersalmoniden machen es uns vor: nicht der kleine eigene Bereich ist unsere Bühne, sondern die Weite und die Offenheit.
Aus diesem Grunde engagiert sich die LMS als eine der wenigen
Institutionen im deutschsprachigen Raum gegenwärtig schwerpunktmäßig in der Unterstützung der Lachsfang- Quotenaufkäufe durch den North Atlantic Salmon Fund von Orri Vigfusson. Wir sind uns bewußt, daß ohne dieses private Engagement auf der Hochsee auch unsere z.T. mit hohem finanziellem Aufwand betriebenen lokalen Wiedereinbürgerungsmaßnahmen weitgehend zum Scheitern verurteilt wären. Die Kette des Lebenszyklus der Wandersalmoniden ist eben nur so tragfähig wie ihr schwächstes Glied! Es ist ein Armutszeugnis eines Landes wie Deutschland, an den aufwendigen Bemühungen des NASF mit Ausnahme privater Spenden mit keinem Pfennig beteiligt zu sein. Hier ernten wir Früchte, die wir nicht gesät haben und tun - auf anderer Ebene - genau das, was wir seitens der "Hobbyfischerei" an der Küste zurecht verurteilen. Hier gilt es, in Hinblick auf das Renaturierungspotential der hiesigen Gewässer eine Beteiligung zu schaffen, die angemessen ist. Nach den gegenwärtigen Größenordnungen ist z.Zt.. ein Beitrag von ca. 5% der Aufwendungen für die Quotenaufkäufe der Färöer und Grönland angemessen, d.h. ein jährlicher Beitrag von DM 100.000 würde Deutschland den Makel nehmen, andere für sich die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen. Auch wenn dieser Betrag auf den ersten Blick astronomisch hoch erscheint, sollte am "fund raising" für diese gute Sache gearbeitet werden. Die LMS tut dies und wird dies weiterhin tun.
Viele weitere sinnvolle und wichtige Betätigungsfelder haben sich für die LMS aus der Praxis der letzten Jahre aufgetan. Hier eine Auswahl:
• Statistische Auswertung von mehreren Tausend historischer Fangdaten zum Lachs vom Niederrhein aus dem letzten Jahrhundert
• Entwurf und Umsetzung eines Datenmodells für die Erfassung von Eierkäufen, Aufzuchten und Besatzmaßnahmen mit
Wandersalmoniden zur Rekonstruktion genetischer Herkünfte
• Erfassung und Betreuung derselben
• Ausarbeitung eines praktischen Leitfadens für die Hygiene in Salmoniden-Satzfischzuchten (Übertragung und Überarbeitung
von norwegischem Literatur-Material)
• Komplettbetreuung der Schriftenreihe "Lachs- und Meerforellen Materialien" mit Organisation, Redaktion und Herstellung
in Abstimmung mit der AFGN
• Erstellung eines Konzeptes für eine "Markierungszentrale" als Anlaufstelle für die Meldung der Fänge markierter Wanderfische
• Erarbeitung der Strukturen für eine systematische Aufnahme und Bewertung der Potentiale der Nebengewässer deutscher Flußsysteme
in Hinblick auf die Eignung für Wandersalmoniden
• Sondierung und Anpassung von Möglichkeiten zum Ausbau der vorhandenen Öffentlichkeitsarbeit
• Aufbau eines Literatur- und Info-Services zu Lachs und Meerforelle
Lachse kennen keine Grenzen - tun wir es ihnen nach.
Peter Olbrich 8/96